

Clare Barlow (Hg.)
Queer British Art, 1861–1967.
On the occasion of the exhibition Queer British art, 1861–1967,
Tate Britain, London, 5 April –1 October 2017,
London: Tate Publishing, 2017, 192 S., zahlreiche Abb., € 30
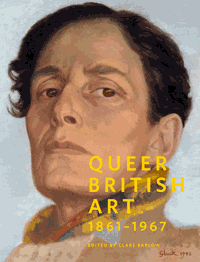
Rezension von Enno Krüger, Heidelberg
Erschienen in Invertito 22 (2020)
"Queer British Art is as much a human history as it is an art history", meint der Direktor der Tate Britain, Alex Farquharson, im Vorwort des Katalogs zur Ausstellung Queer British Art 1861–1967, der nunmehr erschienen ist. Eine so prominente Kulturinstitution präsentierte, glückliches Großbritannien, einen historischen Querschnitt durch die queere Kunst des eigenen Landes. Zwei einschneidende Gesetzesreformen markieren den historischen Bezugsrahmen dieser Ausstellung: 1861 die Abschaffung der Todesstrafe für Sex unter Männern und 1967 die Legalisierung einvernehmlicher homosexueller Akte unter Männern über 21 in Privaträumen. In Schottland erfolgte diese Legalisierung erst 1980. Gegenstand dieser Rezension ist nicht die Ausstellung, die ich nicht gesehen habe, sondern der ihr gewidmete informative, reichhaltig illustrierte und angenehm handliche Katalog.
Ein derart ambitioniertes Unterfangen kommt um eine Definition von queer art nicht herum. Ist ein männlicher Akt oder das Selbstbildnis einer offen lesbischen Malerin schon ein queeres Kunstwerk? Clare Barlow hält sich in ihrer Einführung, die sie an der Ideengeschichte von "queer" entwickelt, nicht mit akademischen Streitfragen auf (S. 11–17), sondern folgt neueren kunsttheoretischen Ansätzen. Die Interpretation eines Kunstwerks könne Wahrnehmungen und Projektionen des Betrachters und der Betrachterin mit einbeziehen, die aber im kulturhistorischen Kontext der jeweiligen Rezeptionssituation beurteilt werden müssten. Das Problem, wie das Werk ursprünglich gemeint gewesen sei, löse sich nicht auf, relativiere sich aber genauso wie etwa die Frage nach der sexuellen Orientierung des Künstlers oder der Künstlerin, die uns vor noch größere methodische Schwierigkeiten stelle.
Den Objekten ist anzumerken, dass Barlow sie mit dem Blick der Museumskuratorin ausgewählt hat, sie alle genügen gewissen ästhetischen Ansprüchen, und viele von ihnen haben den Weg in museale Sammlungen gefunden. Ein breites kunstgeschichtliches Spektrum öffnet sich. Zwischen 1861 und 1969 wechselten sich verschiedene Kunststile ab, die in diesem Katalog auch vertreten sind: "The exhibition touches pre–Raphaelitism and English impressionism, fin–de–siècle aestheticism and Bloomsbury Group modernism, surrealism and neo–romanticism, pop and kinetic art" (S. 7). Vollständigkeit wurde in der Tate Britain nicht angestrebt; ein kunstgeschichtliches Handbuch über queere Kunst oder gar ein Nachschlagewerk zu queeren Künstlern und Künstlerinnen kann und will der Katalog nicht sein. Es gibt viel zu entdecken. Zu den Besonderheiten der deutsch–britischen Kunstbeziehungen gehört es, dass man wenig voneinander weiß. Bis auf wenige Ausnahmen wie Cecil Beaton (1904–1980), David Hockney (* 1937) und Francis Bacon (1902–1992) dürften die meisten vorgestellten Künstler in Deutschland unbekannt sein. Das gilt erst recht für Künstlerinnen wie Hannah Gluckstein alias Gluck (1895–1978), deren Porträtkopf uns streng vom Cover anschaut.
Zur Gliederung des Katalogs: Skulpturen, Ölgemälde, Zeichnungen, Grafiken und kunstgewerbliche Gegenstände werden in chronologischer Reihenfolge einzeln vorgestellt, auch Fotos und Magazine sind einbezogen. Pornographisches ist vermieden, was wohl auch der Grund ist, warum eine so prominente Antikenfälschung wie der Warren Cup im British Museum nicht vorgestellt wird, was in diesem Einzelfall sehr bedauerlich ist. Neben den üblichen Bilddaten informieren kurze Texte über Entstehung und ikonographische Details der einzelnen Objekte. Die Katalognummern sind zu acht Gruppen gebündelt, was es den Autorinnen und Autoren ermöglicht, die Objekte zumindest ansatzweise in Beziehung zueinander zu setzen. Dabei kommt beispielsweise die Rolle des Theaters zur Sprache (S. 69–83). Ironisch könnte man durchaus zutreffend anmerken, dass der Katalog mehr Fragen aufwerfe als beantworte, aber das kann bei einer solchen Pionierleistung, wie der Katalog es zweifellos ist, nicht anders sein. In Deutschland kenne ich nichts Vergleichbares.
Ich greife drei Beispiele heraus, um anzudeuten, mit welchem Material wir es zu tun haben. Die nackten Jünglinge, die sich in den Gemälden von Henry Scott Tuke (1858–1929) an Ufern tummeln, sind heute Inkunabeln homoerotischer Kunst. Das Thema wiederholt sich in seinem Gesamtwerk. Von der zeitgenössischen Kunstkritik wurden diese stimmungsvoll beleuchteten Akte jedoch ebenso wenig als Lustobjekte wahrgenommen wie etwa Max Liebermanns Badende Knaben. Der Aufnahme des Künstlers in die Londoner Royal Academy of Arts standen sie 1914 nicht im Wege. Nicht das Thema des jugendlichen Aktes an sich lässt aufhorchen, sondern seine Akzentuierung. Es sind ein bisschen zu viele jugendliche Körper, als es für die Gestaltung einer klassischen Idylle notwendig gewesen wäre, zumal männliche Nacktheit hier ohne jede mythologische Verbrämung auskommt.
Einen nackten jungen Mann sehen wir auch in einem Ölgemälde von Christopher Wood (1901–1930), das 1930 entstand. Die Figur steht in einem engen Raum, die Fensterläden sind fast geschlossen, auch ein Bett ist vorhanden. Daran ist zunächst einmal nichts spezifisch Homoerotisches. Die Wahrnehmung des Bildes verschiebt sich, wenn wir erfahren, dass Francis Rose, der Freund des Künstlers, dargestellt ist, wie er sich während einer gemeinsamen Frankreichreise in einem Hotelzimmer aufhält. Es gehört zur Hermeneutik queerer Kunst, dass sie sich oft erst aus dem biographischen Hintergrund heraus erschließt.
Ein Bild von Dorothy Johnstone (1892–1980) schließlich, 1923 datiert, gehört zu der an sich "unverdächtigen" Gattung des Atelierbildes. Zwei junge Frauen beugen sich im Vordergrund eifrig über eine Aktzeichnung. Ihr hübsches weibliches Modell lehnt sich erschöpft, aber in "malerischer" Haltung an den Sitz, von dem es herabgestiegen ist. Hier wird nicht nur ein potentielles Objekt des gleichgeschlechtlichen Begehrens gezeigt, sondern auch der weibliche Blick darauf im Bild selbst thematisiert. Im geschützten Raum einer Kunstschule für Frauen ist die Präsentation weiblicher Nacktheit durchaus gesellschaftlich akzeptabel. Es ist die Atmosphäre weiblicher Vertrautheit und Zusammenarbeit, die diesem Bild eine besondere Note verleiht.
Im Vergleich zu den textlastigen Ausstellungskatalogen, wie sie hierzulande üblich geworden sind, kommt der recht schmale Band erfrischend unprätentiös daher. Der Katalog führt deutlich und nuancenreich vor Augen, welche immense Rolle das ästhetische Codieren von gleichgeschlechtlichem Begehren in der Emanzipationsgeschichte sexueller Minderheiten gespielt hat, lange bevor rechtliche und politische Ansprüche öffentlich formuliert werden konnten. Nun aber scheint die Zeit der queeren Kunst abgelaufen zu sein. Es ist nicht etwa so, dass ihr Talente und Kreativität ausgegangen wären. Aber die Voraussetzungen haben sich gewandelt. Prominente aus Mode, Film und Sport haben den Künstler und die Künstlerin längst als queere Leitbilder abgelöst. Brauchen sexuelle Minderheiten heute noch die bildende Kunst, um sich ihrer kollektiven Identität zu versichern?
